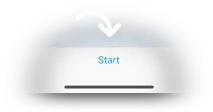Kirill Nazarenko: Wie wird man Millionär in der Karibik?

Sie lesen einen Artikel, der während der Entwicklung des Piraten-Lebenssimulationsspiels Corsairs Legacy vom Studio Mauris mit dem Ziel erstellt wurde, das Marinethema im Allgemeinen und Piratenspiele im Besonderen zu popularisieren. Den Neuigkeiten zum Projekt können Sie auf unserer Website, in unserem YouTube-Kanal und auf Telegram folgen.
In diesem Artikel erzählt Kirill Nasarenko, wie man zum Millionär in der Karibik werden konnte.
Guten Tag! Heute erzähle ich Ihnen, wie man in der Karibik zum Millionär werden konnte.
Zu allen Zeiten war es nicht einfach, Millionär zu werden, und wir wissen zumindest aus der Serie „Black Sails“, dass die Schatzsuche ein sehr gefährliches Geschäft war. Schauen wir uns zunächst an, wie gewöhnliche Menschen lebten, keine Piraten, und wie man seinen Lebensunterhalt verdienen konnte, ohne zur See zu fahren und sich mit Seeräuberei zu beschäftigen.

Die Serie "Black Sails"
Wenn wir über die Karibik sprechen, musste man sich zunächst fragen, wie man überhaupt in diese Region gelangt. Zuerst musste man einen langen Weg von Europa nach Amerika zurücklegen. Wenn man heute den Flugplan ansehen, ein Ticket kaufen und sicher sein kann, dass man in wenigen Stunden auf der anderen Seite des Globus am Flughafen ankommt, musste man im 17. oder 18. Jahrhundert eine lange Seereise auf sich nehmen.
Um sich vorzustellen, wie lange die Reise nach Amerika dauern konnte, nenne ich Zahlen für die Rückreise. In Spanien wurden die Statistiken genau geführt, wenn die Silberflotte von der Karibik auf die Iberische Halbinsel fuhr: die kürzeste und schnellste Überfahrt nach Europa dauerte 40 Tage, und die längste Reise etwa 160 Tage, also mehr als 5 Monate unterwegs.
In etwa demselben Rahmen konnte auch die Hinfahrt schwanken, denn alles hing von den Wetterbedingungen ab, vor allem vom Wind. In gewissem Maße hing es auch von der Geschicklichkeit des Kapitäns ab, denn der Kapitän konnte den Korridor mit günstigen Winden verlassen, oder ein Sturm konnte das Schiff aus diesem Korridor herauswerfen, und dann befand man sich in einer äußerst schwierigen Lage, irgendwo in einer Flaute.
Ebenso war es schwierig, das Kap Hoorn zu umrunden. Das Kap Hoorn konnte man in ein paar Wochen runden, oder man konnte es ein halbes Jahr lang vergeblich versuchen. Deshalb werden selbst moderne Seeleute sehr nervös, wenn Passagiere fragen: „Wann kommen wir in den Hafen X?“ Die Seeleute sagen, dass sie dorthin fahren, aber wann genau, darüber spricht man besser nicht laut.
Um also vor 300 Jahren überhaupt von Europa nach Amerika zu gelangen, musste man ziemlich lange an Bord eines Schiffes leben. Die ganze Zeit über musste man etwas essen, und man musste für die Überfahrt zahlen. Und wenn Sie denken, dass man von Europa nach Amerika in einer bequemen Kabine reisen konnte, dann irren Sie sich höchstwahrscheinlich.

Die Serie "Black Sails"
Um in einer bequemen Kabine zu reisen, musste man ein sehr reicher Mensch sein, denn die Schiffe jener Zeit hatten keine klare Spezialisierung, es gab keine Passagier- oder Frachtschiffe, sie waren universell. Und sagen wir, wenn es ein Frachtschiff war und Sie sehr reich waren, konnte der Kapitän Ihnen die einzige Kabine überlassen, die sich im Achterteil des Schiffes auf dem Oberdeck befand. Dann standen Ihnen 15–20 Quadratmeter Fläche mit einer Höhe von etwa zwei Metern zur Verfügung, in denen Sie sich aufhalten konnten.
Natürlich reisten mehrere Diener mit Ihnen, wenn Sie sehr reich waren, sodass Sie diese 15–20 Quadratmeter trotzdem mit mehreren Personen teilen mussten. Aber Sie konnten zum Beispiel einen Vorhang aufhängen und die Kabine in ein Schlafzimmer und ein Arbeitszimmer unterteilen, oder eine Ecke für die Dienerschaft abtrennen. Sie konnten die Kapitänstoilette in der Heckgalerie benutzen. Kurz gesagt, Ihre Reise wäre relativ komfortabel verlaufen. Allerdings hätten Sie sich während dieser Reise kaum waschen können. Die Diener hätten für Sie gekocht und, falls Sie nicht seekrank waren, hätten Sie mehr oder weniger normal gegessen.
Wenn Sie nicht viel Geld hatten, dann mussten Sie auf dem Hauptdeck hausen. Handelte es sich um ein kleines Handelsschiff, dann war es der Cockpitbereich, also ein Deck auf Höhe der Wasserlinie, in dem es keine Bullaugen gab. Man hätte Ihnen eine kleine Ecke in diesem Cockpit abgetrennt, wo Sie in völliger Dunkelheit schlafen, aber den Tag irgendwo an Deck verbringen konnten.
Wenn es ein großes Schiff war, gebaut wie eine Fregatte oder ein Linienschiff, dann konnte es auf dem Geschützdeck Kabinen geben, wo keine Kanonen standen. Diese konnten mit Brettern abgetrennt werden, und dann hätten Sie ein Kanonenport gehabt, das Sie öffnen und (bei gutem Wetter) das Meer betrachten konnten. Bei schlechtem Wetter musste das Port geschlossen werden, und Sie befanden sich wieder in völliger Dunkelheit.
Wenn Sie sehr wenig Geld hatten, dann gab es nur einen Weg, auf die andere Seite der Welt zu gelangen: als Hilfskraft auf einem Schiff anzuheuern, um für Kost und Logis allerlei Drecksarbeit zu erledigen. Dafür bekamen Sie Essen und einen Schlafplatz. Die Gewohnheit, in Kojen zu schlafen, steckte noch in den Kinderschuhen, und längst nicht jeder Matrose schlief in einer Koje. Sehr oft schlief man einfach auf dem Deck, mit irgendeinem Lappen unter sich oder direkt auf den blanken Planken. Und in diesem Fall hätten Sie sich wahrscheinlich während der ganzen Seereise nicht ausziehen können, ganz zu schweigen vom Waschen.
Und wenn Sie eine Frau oder ein Kind gewesen wären, hätten Sie trotzdem zahlen müssen – entweder mit Geld oder, wie man sagt, mit dem eigenen Körper – und die Reise wäre auf jeden Fall eine harte Prüfung gewesen.
Es gab noch eine andere Möglichkeit, in die Karibik zu kommen: Sie konnten sich als Schuldsklave verpflichten. Das heißt, ein reicher Mensch bezahlte Ihre Überfahrt, in der Minimalversion mit etwas Komfort, und danach mussten Sie für diese Person 3 bis 7 Jahre lang umsonst für Kost und Logis arbeiten. Auf diese Weise gelangte der berühmte Captain Henry Morgan in die Karibik. Er arbeitete mehrere Jahre als Lehrling bei einem Messerschmied. Aber auch hier hing alles davon ab, bei welchem Herrn man landete: bei einem halbwegs guten oder einem schlechten. Denn man musste diese 3 oder 7 Jahre erst einmal überleben.

Piratenkapitän Henry Morgan
Grundsätzlich konnte man auch auf Kosten von Wohltätern nach Amerika gelangen, besonders wenn man zu einer religiösen Gemeinschaft gehörte, etwa zu den Quäkern. Wohlhabende Quäker konnten die Übersiedlung ihrer Glaubensbrüder nach Amerika finanzieren. Dann wären Sie allerdings eher auf dem Gebiet der heutigen USA gelandet und nicht in der Karibik. Und es wurde davon ausgegangen, dass Sie dort Landwirtschaft betreiben und in der Gemeinschaft dieser Quäker leben würden.
Natürlich konnte man auch verbannt werden. Rafael Sabatinis „Die Abenteuer des Captain Blood“ – wir alle haben dieses Buch gelesen und wissen, dass das Gericht anstelle einer Gefängnisstrafe die Verurteilung zur zeitweiligen Sklaverei in der Karibik aussprechen konnte. Diese Sklaverei war jedoch zeitlich begrenzt. Rechtlich war sie nicht lebenslang, sie dauerte eine bestimmte Anzahl von Jahren, die das Gericht festlegte. Aber auch hier musste man erst einmal lange genug leben, um das Ende seiner Strafe zu erleben.
Man konnte in die Karibik auch als Angestellter eines reichen Kaufmanns gelangen oder, noch besser, als dessen Sohn, der zum Handeln geschickt wurde. Oder als jemand, der in Europa bereits Kapital angesammelt hatte und in die Karibik kam, um es in Plantagenwirtschaft zu investieren. Wir betrachten hier aber den Fall, wie man aus dem Nichts zum Millionär werden könnte.
Ich erinnere an eine Anekdote über einen amerikanischen Millionär des 20. Jahrhunderts, der mit einem Dollar in der Tasche in die USA kam, ein Kilo schmutzige Äpfel kaufte, sie direkt im Hudson wusch und für zwei Dollar verkaufte. Dann kaufte er 2 Kilo schmutzige Äpfel, wusch sie im Hudson und verkaufte sie für 4 Dollar. Und dann fragt ihn der Journalist: „Haben Sie so Ihr Millionenvermögen gemacht?“ Und er antwortet: „Nein, danach habe ich geerbt.“ Das soll heißen, dass es fast unmöglich ist, aus dem Nichts eine Million zu machen. Natürlich gibt es solche Fälle, aber meiner Meinung nach ist es einfacher, im Lotto zu gewinnen.
Schauen wir uns nun unsere Möglichkeiten in der Karibik am Ende des 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts genauer an.
Sobald wir in der Karibik waren, mussten wir irgendwie leben und konnten uns eine Anstellung suchen. Alles hing von unseren Fähigkeiten ab. Wenn Sie in Europa ein Handwerk erlernt hatten, konnten Sie als Geselle eines örtlichen Meisters Ihres Faches arbeiten und in ein paar Jahren genug Geld ansparen, um Ihr eigenes Werkzeug zu kaufen und eine eigene Werkstatt zu eröffnen. Das war wahrscheinlich der typischste Weg für jemanden, der „ein Handwerk in den Händen“ hatte und in die Karibik kam.
Wenn Sie Seemann waren, konnten Sie natürlich für Fahrten angeheuert werden. Und ein erfahrener Seemann war auf jedem Piratenschiff willkommen – Ihre Fähigkeiten wären dort sehr nützlich gewesen.
Wenn Sie eine gewisse Bildung hatten, zum Beispiel im Seewesen und in der Navigation, dann war Ihre Laufbahn praktisch vorgezeichnet. Sie konnten zunächst Steuermann-Assistent werden und sich dann zum Steuermann hocharbeiten. Ich erinnere daran, dass Kapitäne von Handelsschiffen, die sich meist von einfachen Matrosen hochgearbeitet hatten und auf der sozialen Leiter eher unten standen, Skipper genannt wurden. Waren sie aber des Lesens und Schreibens mächtig, konnten sie sich Wissen von anderen Skippern oder deren Gehilfen aneignen und lernen, mit Hilfe von Sternen und Planeten die Position des Schiffes zu bestimmen.
Ich erinnere daran, dass es sehr schwierig war, die genaue Position des Schiffes zu bestimmen – der Chronometer wurde erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erfunden. Daher war es vor seiner Erfindung unmöglich, genau zu bestimmen, wo wir uns zwischen London und zum Beispiel Barbados befanden. Man wusste nur, dass man irgendwo dazwischen war. Chronometer wurden in der Kriegsflotte erst in den 1780er Jahren breit eingesetzt, und in die Handelsschifffahrt gelangten sie erst im 19. Jahrhundert, da sie sehr teuer waren und Reeder lieber ohne sie auskamen – zumal der Umgang mit einem Chronometer viel Erfahrung verlangte. Er musste regelmäßig überprüft werden, und all das war recht kompliziert.

Marinechronometer
Es war wesentlich einfacher, unsere Position relativ zum Äquator zu bestimmen, also zwischen Äquator und Pol, indem man den Höchststand der Sonne beobachtete und den Winkel zwischen der Sonne im höchsten Punkt und dem Horizont maß. Das war relativ einfach, und fast jeder konnte das lernen. Mit den primitivsten Instrumenten konnte man die Breite grob bestimmen, so dass man einen Kurs parallel zum Äquator wählen konnte, der einen in die Karibik oder zurück nach Europa führte. Danach musste man nur warten, bis der Ausguck „Land voraus!“ rief.
Da wir gerade von Navigation sprechen: Das Barometer war eine Seltenheit, erst an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert gehörte es zur Ausrüstung der Seeleute, und sogar in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts galten Seeleute, die das Barometer zu nutzen wussten, als große Leute, weil sie das Wetter vorhersagen konnten. Ein fallender Luftdruck bedeutete, dass in etwa einem Tag ein Sturm kommen würde, und ein steigender Quecksilberspiegel kündigte das Ende des Sturms an. In der Handelsschifffahrt wurde das Barometer erst Mitte des 19. Jahrhunderts massenhaft verwendet.
Vorher verließen sich die Skipper auf Intuition und Erfahrung, die vieles ersetzen konnten. Hatte man genug Erfahrung gesammelt, war des Lesens und Schreibens mächtig und konnte mit einem einfachen Quadranten den Sonnenstand messen und Karten lesen, dann verfügte man über viele Fähigkeiten, die einem erlaubten, sich als Skipper eines Handelsschiffes ziemlich sicher zu fühlen. In diesem Fall konnte man sich natürlich schnell aus der Masse der gewöhnlichen Matrosen herausheben.
In einer Piratenmannschaft hätten Sie schnell die Rolle eines Navigators oder Quartiermeisters übernehmen können, der unter anderem für die Aufteilung der Beute zuständig war. Wenn Sie dazu noch mutig und körperlich stark waren, war Ihr Leben in gewissem Sinne abgesichert. Wenn Lesen und Schreiben allerdings nicht zu Ihren Stärken zählten, wurde alles deutlich komplizierter.
Wenn Sie noch kein Handwerk gelernt hatten, war Ihr Möglichkeitskorridor recht eng. Sie konnten sich bei einem Handwerker als Lehrling verdingen, doch wenn Sie bereits um die 20 Jahre alt oder älter waren, war es schwer, als Lehrling angenommen zu werden, denn Lehrlinge waren meist Jungen, die man unbarmherzig herumkommandierte, die im Haus aufräumten, und die, wie in Tschechows Geschichte über Wanka Schukow, auch mal mit einem Hering ins Gesicht geschlagen wurden. Ein junger Mann von etwa 20 hätte auf eine solche Behandlung womöglich zurückgeschlagen. Und wenn er zurückschlug, hätte er schnell seinen Lehrplatz verloren – auch das war nicht einfach.
Man konnte sich als Tagelöhner verdingen, aber Tagelöhner zu sein, war das absolute untere Ende – ein ungelernter Arbeiter mit sehr niedrigem Lohn. In Frankreich erhielt ein landwirtschaftlicher Tagelöhner im 18. Jahrhundert zum Beispiel 4–5 Taler oder Piaster im Monat.

Taler
Auf den ersten Blick scheint das nicht wenig, denn der Piaster ist eine Silbermünze mit 27,2 Gramm Feinsilber. Zusammen mit der Legierung wog sie etwa 30 Gramm. Zum heutigen Silberkurs ist das nicht viel – etwa 70 US-Cent pro Gramm Silber, also rund 19 US-Dollar für einen Piaster. 19 Dollar sind kein besonders hoher Betrag. Aber man kann den Wert eines Piasters nicht einfach am Silberkurs festmachen, sondern muss ihn am Goldkurs messen, da das Verhältnis von Silber zu Gold im 18. Jahrhundert ganz anders war als heute: heute etwa 1:80, im 18. Jahrhundert etwa 1:15, im frühen 16. Jahrhundert sogar 1:10.
Wenn wir also nach Gold umrechnen, entspricht ein Piaster des späten 17. Jahrhunderts etwa 2 Gramm Gold, und das wären heute etwa 110–120 US-Dollar – also ein durchaus normaler Betrag. Ich denke, dass diese Umrechnung eines Piasters in heutiges Geld relativ korrekt ist. Dennoch müssen wir verstehen, dass jede Umrechnung von Geld aus dem 18. Jahrhundert in moderne Werte ungenau ist, denn im 18. Jahrhundert konnte man sich keine Glühbirne, kein Smartphone und keine Waschmaschine kaufen – all das existierte noch nicht.
Andererseits waren die damals hergestellten Stoffe im Verhältnis zu Arbeit und Material deutlich teurer als moderne, aber dafür hielten Kleidungsstücke, die aus ihnen genäht wurden, viel länger. Ein Tuchrock konnte seinem Besitzer mehrere Jahre dienen, und das galt als völlig normal: man flickte ihn, reinigte ihn gründlich und konnte ihn am Ende sogar „umdrehen“, also auftrennen, auf links drehen und wieder zusammennähen, wobei man den Verschluss versetzen musste. Ein armer Mensch konnte so ein Kleidungsstück fünf, sieben oder sogar zehn Jahre tragen, wenn er sorgfältig damit umging. Heute würde man Kleidung, die man mehrere Jahre täglich trägt, höchstwahrscheinlich wegwerfen.
Ich meine regelmäßiges tägliches Tragen, denn die Menschen des 17.–18. Jahrhunderts hatten bei weitem nicht so viele Kleidungsstücke wie wir heute, und es gab keine Vielfalt an Stilen. Wir können heute Sportkleidung, festliche, Freizeit- und Arbeitskleidung haben, aber im 18. Jahrhundert hatten alle ein einziges Kleidungsstück desselben Schnitts.
Der Unterschied bestand eher darin, dass ein reicher Mensch zehn Samtrocken haben konnte, während ein armer einen groben Wollrock besaß, aber ihr Aufbau war derselbe. Das bedeutet, dass Stoff im 18. Jahrhundert im Verhältnis zu Arbeit und Materialeinsatz teurer, haltbarer und zuverlässiger war als heutige Stoffe. Ganz zu schweigen davon, dass jeder Stoff damals in Handarbeit auf Webstühlen hergestellt wurde und wesentlich mehr Arbeitsstunden pro Meter erforderte.

Kapitäns- und andere Herrenbekleidung des 18. Jahrhunderts
Um zu verstehen, was ein Lohn von 4–5 Talern im Monat für einen Tagelöhner bedeutete, muss man wissen, dass ein Meter Tuch mit einer Breite von etwa eineinhalb Metern (ich übersetze in moderne Einheiten) selbst bei billigem Soldatenstoff etwa 0,7 Piaster pro Meter, bis hin zu einem Piaster kosten konnte. Das heißt, für einen Monatslohn konnte ein Tagelöhner Stoff kaufen, um sich einen Rock und eine Hose nähen zu lassen. Natürlich musste er dennoch etwas essen und irgendwo wohnen, und diese 4–5 Piaster galten ohne Essen und Unterkunft – all das musste er selbst bezahlen. Und wenn ein Tagelöhner Kost und Logis gestellt bekam, war sein Lohn geringer.
Zudem konnte ein Tagelöhner von seinen Arbeitgebern abgelegte Kleidung als Teil des Lohns erhalten. Aber klar ist, dass man sich bei einem solchen Lohn nicht mehr als ein einziges Kleidungsset pro Jahr leisten konnte. Und wenn man dieses Set täglich trug und dazu körperlich arbeitete, verschliss es schnell und verwandelte sich innerhalb eines Jahres in Lumpen. Von diesem Geld konnte man sich nur bescheidene Nahrung leisten.
Um zu verstehen, wie das alles funktionierte, können wir uns die Preise verschiedener Waren in Europa ansehen. Vor allem jener Produkte, auf denen die karibische Wirtschaft beruhte – Zucker, Kaffee, Farbstoffe, teilweise Tabak und Reis.
In Amsterdam zu Beginn des 18. Jahrhunderts konnte man für einen Piaster zwischen drei und sieben Pfund Kaffee kaufen, also zwischen etwa einem und zwei Kilogramm, je nach Qualität. Arabica-Kaffee aus dem Osmanischen Reich galt als besonders hochwertig, während Kaffee aus der Karibik als minderwertiger und daher günstiger galt. In Europa waren 1–2 Kilogramm Kaffee einen Piaster wert, in der Karibik kosteten diese 1–2 Kilogramm Kaffee zehnmal weniger. Das Wichtigste war, Kaffeebäume zu pflanzen – dann trugen sie Früchte, und man musste nur eine gewisse Anzahl von Sklaven für die Ernte vorhalten.
Sklaven waren billig: Ein afrikanischer Sklave in der Karibik kostete nur 12 Taler (12 Piaster), also so viel wie 12 bis 24 Kilogramm Kaffee an der Amsterdamer Börse. Es ist offensichtlich, dass die Arbeitskosten bei der Kaffeeproduktion gering waren.
Zucker, genauer gesagt Rohzucker (Zucker in der Form, in der er aus Amerika nach Europa geliefert wurde), konnte man für einen Taler in einer Menge von etwa 8 Kilogramm kaufen. Umgerechnet auf den Preis eines Sklaven entspricht das etwa 100 Kilogramm Rohzucker – so viel kostete ein Sklave. Menschen waren also sehr billig. Raffinierter Zucker kostete etwa 2,5–3-mal so viel.

Afrikanische Sklaven arbeiten auf Zuckerrohrplantagen
Das Raffinieren von Zucker war ein komplexes Verfahren. Man leitete ihn durch einen Filter aus gemahlenem, verbranntem Knochen, wodurch der Zucker eine helle Farbe – hellgelb oder fast weiß – und weniger Verunreinigungen erhielt. Doch in der Regel wurde das Raffinieren bereits in Europa vorgenommen; es war ein lukratives Gewerbe, und aus der Karibik wurde hauptsächlich Rohzucker exportiert.
Nehmen wir Reis: Für einen Taler konnte man in Europa etwa 15 Kilogramm Reis kaufen, in der Karibik natürlich deutlich mehr.
Um weitere Preisbeispiele zu geben: Eine Flasche Champagner kostete im 18. Jahrhundert etwa 2/3 Piaster, also konnte man für 2 Piaster drei Flaschen Champagner kaufen – ein sehr teurer Wein. Andererseits konnte ein Affe in Europa etwa 25 Taler kosten. Ein Affe wurde somit zum etwa doppelten Preis eines Sklaven in der Karibik verkauft – eine interessante Relation.
Parmesankäse, den Billy Bones so liebte, für das kleine Stück, das auf die Seite der Helden von „Die Schatzinsel“ überging, kostete etwa 2/3 Piaster pro Kilogramm. Parmesan war also ungefähr so teuer wie eine Flasche Champagner. Nur wohlhabende Menschen konnten sich Champagner und Parmesan leisten. Einfacher Käse, etwa holländischer, kostete 3–4-mal weniger.
Was Waffen angeht: Waffen waren relativ günstig. Zum Beispiel kostete eine Schwertklinge ohne Griff und Scheide etwa einen Taler. Dabei war sie durchaus hochwertig – keine Damastarbeit, aber ein solider Durchschnitt, mit dem man durchaus auf Kaperfahrt gehen konnte. Für Griff und Scheide zahlte man etwa einen weiteren Piaster. Ein gebrauchsfertiges Schwert kostete in Europa also ungefähr zwei Piaster, in der Karibik etwas mehr – vielleicht 3–4 Piaster. Damit war ein Schwert sogar billiger als ein Sklave, selbst ein relativ günstiger.
Hier stellt sich die Frage: Wenn wir darüber sprechen, wie man Millionär wird – wie konnte man sich aus der Position eines Tagelöhners oder Lehrlings herausarbeiten und ein Startkapital ansammeln? Natürlich gab es damals keine Patentrezepte (und ich werde Ihnen heute auch keine „Wunderformel“ verraten), aber man konnte sich einen gewissen Betrag leihen und damit erfolgreich Handel treiben. Nur stellte sich die wichtige Frage: Wer leiht einem Landstreicher Geld, wenn man einer ist?
Zunächst mussten Sie sich anständig kleiden, dann mussten Sie irgendeinen wohlhabenden Menschen davon überzeugen, Ihnen Geld zu leihen. Die Bevölkerung in den karibischen Kolonien war klein, und auf jeder Insel kannten sich mehr oder weniger alle; es war also überhaupt nicht schwer, sich nach Ihrem Ruf zu erkundigen. Wenn Bekannte dieses reichen Mannes sagten, Sie seien ein Lump aus Europa, der anständige Kleidung irgendwie ergaunert habe, dann hätten Sie wohl keinen Kredit bekommen. Außerdem vertraute man in jenen Zeiten kaum bloßen Worten – man hätte von Ihnen Sicherheiten verlangt.
Also zurück zur Frage: Woher sollten Sie diese Sicherheiten nehmen? Dann konnten Sie sich in die Handelsgesellschaft eines Kaufmanns aufnehmen lassen, der Waren aus der Karibik nach Europa verschiffte. Hatten Sie Glück und Ihr Schiff geriet nicht in Stürme oder in die Hände von Piraten, konnten Sie sich in ein paar Fahrten ein bescheidenes Kapital ansparen, selbst ein Schiff chartern, weiter sparen und immer wieder in Ihr Geschäft investieren, und irgendwann vielleicht ein eigenes kleines Schiff bauen lassen. Am besten tat man das in englischen oder niederländischen Werften, im 17. Jahrhundert eher in niederländischen, denn Holland war das Zentrum des Handelsschiffbaus, man baute dort schnell und billig. In England baute man langsamer und teurer. So konnte man im 17. Jahrhundert beispielsweise ein zweimastiges Schiff – eine Brigg – in Auftrag geben und in der Karibik eigenständig Handel treiben.

Zweimastbrigg
Ich erinnere daran, dass der Handel meist in Form eines Dreiecksverkehrs geführt wurde: Ein Schiff fuhr von Europa nach Nordafrika, wo es eine Ladung Sklaven übernahm und den Afrikanern Waren verkaufte, die sie brauchten – und das waren keineswegs Glasperlen. Glasperlen konnten vorkommen, machten aber nur einen kleinen Teil der Ware aus. Hauptsächlich handelte man mit Schießpulver, Musketen, Blankwaffen und Eisenbarren, so wie es damals üblich war. Denn die Küstenstämme Afrikas waren gut bewaffnet und kannten den Wert europäischer Waren sehr genau. Sie jagten gezielt andere Afrikaner im Landesinneren und verkauften sie an Europäer als Sklaven.
Mit der Sklavenladung fuhr man anschließend in die Karibik, verkaufte die Sklaven, kaufte Zucker, Kaffee, Farbstoffe, Reis und Tabak und brachte diese Waren nach Europa.
Was andere Waren betrifft: Tabak war besonders wertvoll. Ein Pfund Tabak (ein Pfund waren je nach Region etwa 400–500 Gramm) konnte 1 bis 1,5 Taler kosten. In der bekannten Geschichte um den Mohren von Peter dem Großen heißt es, der Zar habe einen afrikanischen Jungen für ein Pfund Tabak gekauft – das war durchaus realistisch, denn wenn ein Sklave in der Karibik 12 Piaster kostete, kostete ein Pfund Tabak 1–1,5 Piaster. Für einen ausgewachsenen Sklaven konnte man also 8 Pfund Tabak zahlen, für einen Jungen 1–2 Pfund. Rauchen war ein teures Vergnügen und im 18. Jahrhundert vielleicht sogar teurer als heute.
Die Verbreitung des Rauchens hing damit zusammen, dass man damit demonstrieren konnte, reich zu sein und Geld buchstäblich zu „verrauchen“. Ein Pfund Tabak kostete so viel wie eine Schwertklinge ohne Griff oder eine Flasche Champagner. Ein Pfund hätte für etwa 800 bis 1000 Zigaretten gereicht – also etwa für einen Monat, wobei eine Pfeife noch mehr Tabak verbrauchte. Wahrscheinlich war es Tabak recht hoher Qualität, ohne besondere Zusätze.
Da der Wunsch zu rauchen groß war, das Geld jedoch knapp, wurde Tabak in Europa häufig verfälscht, indem man allerlei Kräuter beimischte. In den Niederlanden zum Beispiel entstand der Brauch, dem Tabak Hanf beizumischen. Wenn niederländische Raucher des 17. Jahrhunderts ihre Pfeifen stopften, rauchten sie also nicht nur Tabak, sondern eine Art Droge und gelangten in einen recht benebelten Zustand, wie man auf niederländischen Genrebildern gut sehen kann, wo die Trinker und Raucher sichtlich angeschlagen wirken.
In denselben Niederlanden mischte man Schnaps ins Bier. Deshalb war das Rauchen von reinem, gutem Tabak ein teures Vergnügen, und neben dem Rauchen gab es auch das Tabakschnupfen, eine typische Beschäftigung der höheren Schichten. Der Tabak wurde zu feinem Pulver gemahlen, in die Nase gezogen und verursachte Niesen – und selbst prominente Persönlichkeiten taten das. So schnupfte etwa Katharina die Große Tabak und nahm ihn stets mit der linken Hand aus der Dose, damit ihre rechte Hand, die sie den Höflingen zum Handkuss reichte, nicht nach Tabak roch. Interessant ist, dass Rauchen als rein männliche Angelegenheit galt; Damen rauchten, wenn überhaupt, heimlich. Damen durften hingegen Tabak schnupfen.
Wenn wir nun etwas erfolgreicher im Handel gewesen wären, hätten wir in der Karibik eine Plantage kaufen und Sklaven erwerben oder aus Europa mitbringen können und begonnen, Zucker oder Kaffee zu produzieren, oder Reis, Tabak oder verschiedene Färbemittel anzubauen. Auf diese Weise konnte man ein sehr wohlhabender Mensch werden. Aber was das Wort „Millionär“ angeht: Es wäre kaum möglich gewesen, tatsächlich eine Million in der damaligen Währung anzuhäufen – eine Million Piaster ist eine gewaltige Summe.
Zum Vergleich: Der Jahresetat eines entwickelten Landes wie Großbritannien oder Frankreich lag zu Beginn des 18. Jahrhunderts bei etwa 35–40 Millionen Talern. Eine Million Taler im Privatbesitz war also praktisch nirgendwo realistisch. Hätten Sie 100.000 Piaster besessen, wären Sie nach den Maßstäben jener Zeit ein äußerst reicher Mensch gewesen.
Dann stellte sich die Frage, was man mit diesem Reichtum anfangen sollte. Sagen wir, in Großbritannien konnte man zu dieser Zeit bereits einfach ein reicher Mensch sein, ein wohlhabender Kaufmann, denn die Standesschranken waren stark aufgeweicht.
In Frankreich hingegen hätte man bei größerem Reichtum wohl in einen adeligen Titel investieren müssen. Man hätte versuchen müssen, in den Adelsstand aufzusteigen oder einen Titel zu kaufen, um den eigenen Reichtum zu „legitimieren“, denn ein „bloßer reicher Kaufmann“ wurde in Frankreich verspottet. Denken wir an Molières „Der Bürger als Edelmann“ – der bürgerliche Emporkömmling ist eine komische Figur. Nur ein Adeliger, ein Titularadeliger, hatte das „Recht“, wirklich luxuriös zu leben. Möglichkeiten dazu gab es durchaus.
In Italien wurden bereits im 17. Jahrhundert Adelstitel ziemlich offen gehandelt. Man konnte einem Günstling des Papstes eine Summe übergeben und erhielt dafür einen Titel; man konnte Titel von ihren Inhabern kaufen – das galt in Italien als legale Transaktion.
In Frankreich war das schwieriger, denn Frankreich war ein zentralisierter und besser organisierter Staat als Italien. Man musste sich der Königsumgebung über Bestechung nähern, aber auch das war nicht unmöglich: Hatte man Geld, konnte man auch hier einen Titel bekommen. Natürlich wussten alle „echten“ Aristokraten, dass dieser Titel erkauft war und dass man keine vornehmen Vorfahren hatte, aber man konnte so seinen Reichtum rechtlich absichern und in Paris oder in den Provinzen luxuriös leben.
In Spanien war das Problem komplizierter, denn dort gab es weniger unternehmerische Freiheit, und in den Kolonien herrschte mehr Ordnung. Man wird reich, wo wenig oder schlecht Steuern eingetrieben werden; dort, wo Steuern streng erhoben werden, ist es viel schwerer, schnell reich zu werden. In den spanischen Kolonien gab es daher weniger „schnelle Reichtümer“. Aber grundsätzlich konnten auch dort einige wenige reich werden, vor allem jene, die bereits über Startkapital – in Geld oder in Fähigkeiten – verfügten. Wer lesen und schreiben konnte, hatte etwa die Möglichkeit, als Assistent eines Verwalters zu arbeiten und später selbst Verwalter auf einer Plantage zu werden – das bedeutete bereits einen deutlichen sozialen Aufstieg. Wer weder lesen noch schreiben konnte und kein Handwerk beherrschte, stand ganz unten auf der sozialen Leiter, wenngleich das immer noch nicht die absolute Untergrenze war.
Noch tiefer standen die Bauern, die in den meisten europäischen Ländern jener Zeit in Abhängigkeit von Adel und Großgrundbesitzern lebten – selbst dort, wo es formal keine Leibeigenschaft gab. In Osteuropa existierte die Leibeigenschaft rechtlich voll ausgeprägt, nicht nur in Russland, sondern auch in Polen-Litauen, Ungarn, in den östlichen Gebieten Deutschlands und in Böhmen.

Sklaverei in Osteuropa
Selbst dort, wo sie formal nicht bestand – etwa in Frankreich, Italien oder Spanien – war die Abhängigkeit der Bauern von den Grundherren sehr stark. Vor allem die gerichtliche Abhängigkeit, da die Rechtsprechung in den Händen der Feudalherren lag, sowie die Bindung an den Boden. Ein französischer oder spanischer Bauer konnte nicht einfach in die Karibik „auswandern“, denn niemand hätte ihn das Dorf verlassen lassen, in dem er geboren wurde und in dem er sterben sollte. Er hätte fliehen müssen und damit bestehende Rechtsverhältnisse brechen – auch das erschwerte vieles.
Natürlich hat es immer Abenteurer und Glückspilze gegeben, und einige wenige konnten tatsächlich ein Vermögen machen. Aber das waren äußerst seltene Fälle. Die große Mehrheit der Menschen, die in die Karibik gelangten, führte das Leben von Handwerkern, einfachen Matrosen oder im besten Fall Aufsehern auf Plantagen. Millionär zu werden war damals extrem schwierig.
Wir hoffen, dieser Artikel war für Sie interessant und hilfreich!
Erfahren Sie mehr über das Projekt Corsairs Legacy – Historical Pirate RPG Simulator und setzen Sie es auf die Wunschliste in der Steam-Store-Seite des Spiels.